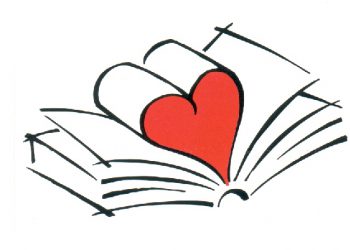Exkursion in die Pinakothek der Moderne nach München
Am Samstag, den 13. Oktober 2012 hat sich das W-Seminar Malerei und einige Interessierte auf den Weg nach München gemacht um die umfassenden Ausstellungen in der Pinakothek der Moderne zu besichtigen – und es hat sich gelohnt!
Ganz gleich ob aus dem Bereich Architektur, Design, Grafik oder Malerei der Moderne – viele der präsentierten Arbeiten kannten wir bereits aus dem Kunstbuch und konnten sie nun endlich im Original bewundern.
Das Naturrecht
1.allgemein rechtsphilosophischer Sinn:
Grundsätze einer (Rechts)Ordnung, die unabhängig von menschlicher Zustimmung, staatlichen Gesetzen oder Regeln und Lehren einer Religionsgemeinschaft existieren. Also die Idee eines Rechtes, das sich nicht menschlicher Autorität verdankt und aller Setzung und Vereinbarung enthoben ist, aber für jede Rechts- und Staatsinstanz unbedingte Verbindlichkeit beansprucht (vorpositive und überpositive Rechtsidee)
2.Naturrecht aus christlicher Sicht:
Der Mensch ist aufgrund seiner Wesensart (Natur) in der Lage, unabhängig von seiner Kultur die göttliche Schöpfungsordnung zu erkennen (DS 3004)
3.Das Naturrecht ist je nach Begründung und Ableitung eine Theonome Ethik = direkt von Gott vorgegebene Ethik -> Röm 2,15: Der Mensch erkennt in seinem Herzen das von Gott eingeschriebene Gesetz
Die Forderung nach einem ethischen Grundkonsens ist notwendig, um das gesellschaftliche Zusammenleben in Ruhe, Frieden und Gerechtigkeit zu garantieren. Die Normenbegründung des Naturrechts kann dazu einen wichtigen (positiven) Beitrag leisten:
–Das Naturrecht ist eine Normenbegründung, die für alle und jedermann, für alle Zeiten und überall auf der Welt bleibende Gültigkeit besitzt (allgemein verpflichtendes Recht).
–Gültige Ordnungen und Gesetze (positives Recht) können dadurch analysiert und ggf. auch bekämpft und korrigiert werden.
–Als oberster Grundsatz gilt: Agere sequiter esse, d. h. das Handeln folgt aus dem Sein. Gut ist, was den (von Gott vorgegebenen) Naturzielen entspricht (Aus dem Indikativ des Seins ergibt sich notwendigerweise der Imperativ des Sollens).
–Die ethische Begründung geht nicht vom konkreten Verhalten, sondern vom Wesen des Menschen aus, damit behält sie Konstanz in einer unruhigen Zeit (nicht jede Mode hat Einfluss auf die Normfindung)
–Der Transzendenzbezug, der schnell vergessen wird, wird hier offen gehalten.
Zum Naturrecht müssen auch kritische Anmerkungen gemacht werden:
–Es ist schwer zu entscheiden, welche Elemente des Menschlichen durch die Naturordnung präformiert, vorentschieden, fixiert – und welche durch die Geschichte zufällig entstanden, also wandelbar sind.
–Die Erkenntnis der Naturtendenz ist weithin zeitgebunden. Neue natur‑ und humanwissenschaftliche Erkenntnisse haben kaum eine Chance eingebracht zu werden (z. B. Möglichkeiten der Empfängnisverhütung, Ziel der Sexualität). Damit ist auch die Gefahr eines naturalistischen Fehlschlusses verbunden.
–Es besteht die Gefahr einer Gesetzesethik, genauerhin die Gefahr, dass Gesetze nicht um des Wertes willen eingehalten werden, sondern allein des Wortlautes wegen.
–Die Abwägung von Nutzen und Schaden für den konkreten Fall kommt zu kurz.
–Menschliches Leben verändert sich in der Gegenwart sehr schnell. Diese Einsicht wird kaum im Naturrecht berücksichtigt.
–Theologische Kritik: Widerspruch zur biblischen Schöpfungslehre (die Schöpfung ist nicht abgeschlossen – creatio continua)
Naturalistischer Fehlschluss:
Logischer Fehler, der oft auch als „Sein‑Sollen‑Fehlschluss“ bzw. „Verstoß gegen das Hume’sche Gesetz“ bezeichnet wird. Aus einem Sein kann nicht logisch zwingend auf ein Sollen gefolgert werden. Beispiel: Durch den Bau der geplanten Straße entlang dieser Trasse würde ein Biotop zerstört (Sein‑Aussage). Deshalb darf die Straße hier nicht gebaut werden (SollenAussage). Damit der Fehlschluss vermieden wird, muss zur Sein‑Prämisse eine Wert‑Prämisse hinzukommen, z. B. unter Bezug auf eine moralische Norm: Im Biotop lebt eine Tierart, die sonst ausstirbt; oder unter Bezug auf eine Rechtsnorm: die im Biotop lebende Tierart ist gesetzlich geschützt. Vor dem Sein‑Sollen‑Fehlschluss warnte bereits David Hume. Der Begriff „naturalistischer Fehlschluss“ geht auf George E. Moore zurück („Principia ethica“, 1903).